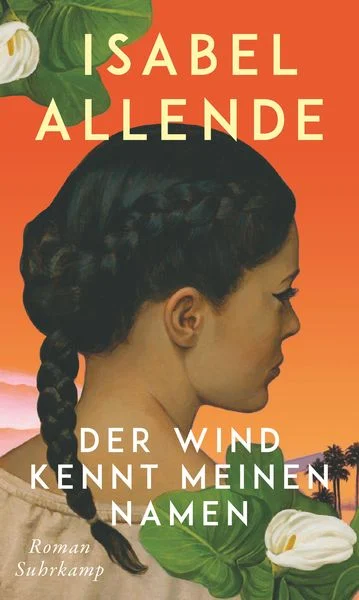ISABEL ALLENDE: „DER WIND
KENNT MEINEN NAMEN“
Sein Kind wegzuschicken, um es zu retten, das ist eine der schlimmsten Entscheidungen, vor
die man Eltern stellten kann. Bei Isabel Allende, einst selbst Flüchtling, stehen gleich
zwei solcher Schicksale im Mittelpunkt ihres jüngsten Romans.
„Der Wind kennt meinen Namen“ lautet der Titel und schon das Eingangsszenario
ist unheilverkündend: November 1938 in Wien, unmittelbar vor der sogenannten
Reichskristallnacht. Zu lange wollten die Eheleute Adler nicht wahrhaben, welche
furchtbare Gefahr sich nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland auch hier den
jüdischen Bürgern drohte.
Der Vater wird in der Pogromnacht schwer zusammengeschlagen und später ins KZ
abtransportiert. Die Mutter wird zwar von einem Nachbarn versteckt, doch zugleich bleiben
ihre verzweifelten Versuche, ein Visum für Chile zu bekommen, erfolglos. In ihrer Not
ringt sie sich dazu durch, wenigstens den sechsjährigen Samuel aus der direkten Gefahr zu
bringen.
Mit nichts als einmal Wechselwäsche und seiner geliebten Geige muss der Junge in den Zug
mit dem Kindertransport nach England steigen. Er ahnt noch nicht, dass er beide Eltern nie
wiedersehen wird, zugleich hat er schwierige Zeiten vor sich, die ihn für den Rest des
Lebens prägen.
Zieheltern kommen nicht zurecht mit ihm, es folgt eine üble Zeit im Waisenhaus, und erst,
als ihn ein wohlwollendes Ehepaar adoptiert, geht es ihm besser. Sein einziger wirklicher
Halt aber waren Geige und Musik und die Schilderung seiner Vita endet vorerst im Jahr
1958, als er in die USA reist, um die dortige neue aufregende Musik kennenzulernen.
Der wie von dieser Meisterin gewohnt mitreißende Erzählstrom wechselt nun ganz nach
Amerika, ins Jahr 2019. Auch hier in Arizona an der Grenze zu Mexiko wird ein Kind von der
Mutter getrennt: die siebenjährige, nach einem Unfall fast blinde Anita Diaz. Hier sind
es keine Nazis, die die Trennung unausweichlich machen, es ist die dezidierte Politik des
amtierenden US-Präsidenten, die auch nicht davor zurückschreckt, Kinder von ihren
Müttern zu trennen und in Lager zu stecken.
Auch Anitas Mutter hatte existentielle Gründe für diese Flucht aus dem mörderischen
Chaos in ihrem mittelamerikanischen Land. Jetzt sitzt das hilflose Mädchen in einem Lager
und von der Mutter fehlt jede Spur. So wie seine Geige Samuel vor der völligen
Verzweiflung bewahrte, flüchtet sich Anita in ihre eigene Fantasiewelt Azabahar.
Dort kann man ohne die Obhut von Eltern sicher leben und in Claudia hat sie ihre
erträumte Freundin. Doch hier gibt es auch Selena Duran, eine Sozialarbeiterin mit
Migrationshintergrund im Lager, die auf legalem Wege versucht, Anitas Mutter aufzuspüren.
Während der Fall der Siebenjährigen wie auch etliche andere Figuren auf wahren
Begebenheiten beruht, kommt nun auch noch Leticia Cordero aus El Salvador ins Spiel, 1982
mit ihrem Vater illegal über die Grenze gekommen. Die Beiden waren durch eine glückliche
Fügung die einzigen Überlebenden des hier quasi unbekannten, historisch aber belegten
barbarischen Massakers vom Dezember 1981, als eine Soldateska in El Mozote die gesamte
Dorfbevölkerung abschlachtete.
Und auch ihre Fluchtgeschichte berührt schließlich die Rahmenhandlung um Samuel Adler,
der jetzt als alter Mann noch einmal ins Spiel kommt. Drei Schicksale über 80 Jahre, die
so grausam für die Kinderseelen waren und so vieles gemeinsam haben.
Isabel Allende stellt mit ihren 81 Jahren noch einmal ihre ganze Kunst als sprachgewaltige
Erzählerin packender Geschehnisse unter Beweis. Das berührt und fesselt und könnte
zugleich aktueller kaum sein. Dass es außerdem absolut filmreif ist, unterstreicht nur
noch die realistische Qualität.
|