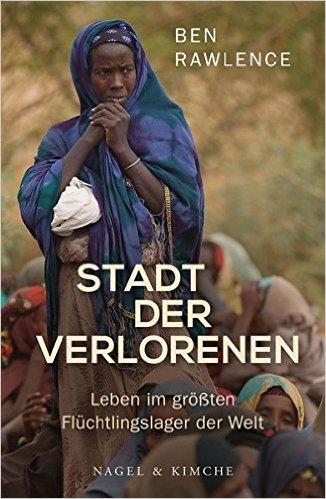BEN RAWLENCE: „STADT DER
VERLORENEN“
Als das Flüchtlingslager Dadaab an der Grenze Kenias zu Somalia 1992 errichtet wurde,
galt es vielen hierher vor der allgegenwärtigen Gewalt und Anarchie im zerfallenden Staat
am Horn von Afrika Geflohenen als „ein Paradies der Möglichkeiten“: Schutz,
Gesundheitsversorgung, Schulbildung und die Aussicht auf eine Emigration in die USA.
Die Realität entwickelte sich radikal anders, denn wer einmal in Dadaab steckt, steckt
hier fast unweigerlich auf Dauer fest. Die Wirklichkeit, die über Jahre entstanden ist,
schildert Ben Rawlence in seinem Buch „Stadt der Verlorenen. Leben im größten
Flüchtlingslager der Welt“. Über mehrere Jahre hat der Autor, der einst in Chicago
unter anderem auch bei Barack Obama studierte, das Lager immer wieder besucht.
Zum Einstieg allerdings berichtet er von seinem Vortrag im Weißen Haus, wo er 2014 dem
Nationalen Sicherheitsrat der USA erklären sollte, was Dadaab, dieser längst zu einem
chaotischen Moloch von etwa 500.000 oder mehr Gestrandeten gewordene Wüstenort, ist. Doch
die Politiker haben ihre festgefügten Vorstellungen von einem solchen vorübergehenden
Durchgangslager, dessen Bewohner zudem überwiegend Muslime sind, inzwischen also generell
verdächtige Individuen. Rawlence betont anhand seiner Erfahrungen zwar: „Armut
führt nicht zwangsläufig zu Extremismus“.
Gleichwohl unterbleiben weitere Fragen, sein Vortrag wird zur Kenntnis genommen und die
Sitzung frühzeitig beendet. Was die Politik nicht nur im Westen lieber nicht sehen will,
beschreibt Rawlence ungeschönt aber auch ohne moralischen Zeigefinger. Vor allem an neun
Einzelschicksalen, wie das der 21-jährigen Sarah: „Meine Mutter kam als Flüchtling
hierher, und dann wurde ich geboren. Ich bin das Kind und die Mutter eines Flüchtlings
und selbst ein Flüchtling.“
Die Gegenwart des Lagers mit den Ausmaßen einer mittleren Großstadt war von Beginn an
improvisiert und ziemlich anarchisch mit sehr eigenen ungeschriebenen Gesetzen, mit
korrupten Ordnungskräften und skrupellosen Kriminellen. Geld gibt es offiziell nicht im
Lager, dennoch geht ohne gar nichts. Es herrscht ein irreales und doch irgendwie
durchorganisiertes System von stadtähnlichen Strukturen.
Die Flüchtlinge, überwiegend Somalier, dürfen Dadaab nicht verlassen und vielen kennen
gar nichts anderes als dieses Lager. Zugleich leben sie in der ständigen Furcht,
irgendwann von einem Tag zum anderen irgendwohin abgeschoben zu werden. Als wären Hunger,
Epidemien, Überschwemmungen oder Dürre in sengender Hitze und Staub nicht schon genug
Drangsal genug, sind längst auch Gefahren wie Polizeiübergriffe, Bandenvergewaltigungen
und terroristische Anschläge allgegenwärtig.
So wie das Lager ständig weiter wucherte, verschlechterte sich die Lage immer mehr. 2012
wurden zwei Spanierinnen vom Hilfswerk „Ärzte ohne Grenzen“ in Lagernähe
entführt. Innerhalb von Stunden stellten sämtliche Hilfsorganisationen ihre Aktivitäten
ein und zogen fast sämtliches Personal ab. Zugleich verschärften sich die
Feindseligkeiten zwischen kenianischen Truppen und somalischen Aufständischen immer
weiter, während just in dieser Zeit die Vereinten Nationen ihre Hilfsmittel erheblich
zurückfuhren – nicht zuletzt übrigens wegen eben jener Syrien-Krise, deren
Millionen Flüchtlinge inzwischen auch Europa vor eine Zerreißprobe stellen.
Im September 2013 sorgte die terroristische al-Shabaab-Miliz aus dem somalischen
Bürgerkrieg mit ihrem blutigen Überfall auf das Westgate-Einkaufszentrum in Nairobi für
massive Hassreaktionen Kenias gegen alle ethnischen Somalis. Wie all dies bei vielen der
leidgeprüften Lagerinsassen die sogenannte „buufis“ hervorruft, eine Art
depressives Fernweh, beschreibt Ben Rawlence dazu ebenso schonungslos und bewegend wie die
Tatsache, dass Dadaab trotz allen Elends für die Schwachen einer ganzen Region ein
wesentlicher Bestandteil ihrer Überlebensstrategie ist.
Das Buch endet schließlich einfach, ohne eine Lösung aufzuzeigen. Wie auch? Es ist
bitter, es tut weh und macht wütend. Und es steht exemplarisch für viele
Flüchtlingslager und ist schon deshalb so ungeheuer wichtig und wertvoll.
|