- Geschrieben von: Wolfgang A. Niemann
- Kategorie: Belletristik (Non-Fiction)
- Zugriffe: 162


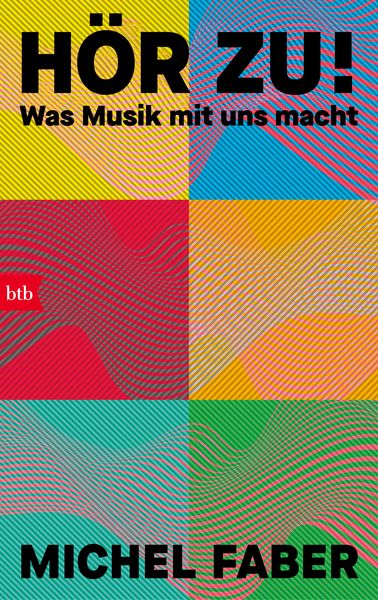
MICHEL FABER: „HÖR ZU!“
Michel Faber ist für meisterhafte Romane wie „Das karmesinrote Blütenblatt“ oder „Das Buch der seltsamen neuen Dinge“ berühmt. Nun aber hat der gebürtige Niederländer, der in Großbritannien lebt, endlich das Buch vorgelegt, das er schon immer schreiben wollte: eines über Musik.
Doch der jetzt 65-Jährige hat nicht etwa über seine Lieblingsbands, über bestimmte Meisterwerke oder besondere Kunstschaffende des Metiers geschrieben. „Hör zu! Was Musik mit uns macht“ lautet der Titel für dieses außergewöhnliche Werk. Fabers Absicht ist nämlich, die Einstellung des Lesers zum Hören zu verändern.
So erläutert er eingangs denn auch, was eigentlich beim Hören passiert und wie wir das Gehörte verarbeiten, also dessen mentale und psychologische Wirkung. Dazu bietet er einerseits viele Fakten, erhebt andererseits jedoch bewusst nicht den Anspruch von objektiver Allgemeingültigkeit seiner Ausführungen.
Faber lässt zwar eine Fülle von wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Soziologie, Psychologie bis hin zur Hirnforschung einfließen, bekennt sich aber als lebenslang leidenschaftlicher Musikkonsument – inklusive des Sammelns besonders von nicht alltäglichen Hörgenüssen – zur Subjektivität der meisten seiner Aussagen.
Warum höre ich Musik überhaupt? Das untersucht er nicht nur ganz persönlich bei sich und empfindet es als schier unbegreiflich, dass tatsächlich fünf Prozent aller Menschen Musik nicht leiden können. Dazu legt er dar, wie jegliche Musik als Zeitmaschine der Erinnerungen und Gefühle wirkt.
Es gehe ausdrücklich auch nicht um Lieblingsmusik und er lehnt Werturteile wie „gut“ oder „schlecht“ ab, egal, ob es sich Blasmusikanten, Beethoven oder die Beatles handelt. Niemand habe das Recht, einem anderen einen schlechten Musikgeschmack vorzuwerfen.
Entsprechend mokiert sich der Musikbesessene auch über den Sinn und Unsinn von Ranglisten wie „100 Beste Rock-Alben“, zumal hier oft auch die Manipulation seitens der ausbeuterischen Musikindustrie eine große Rolle spiele. Und er bekennt, dass er trotz aller Bemühungen nie gelernt habe, auch die Klassik zu mögen.
Da störe ihn nicht zuletzt „die Aura gottgegebener Unanfechtbarkeit“, dabei sei klassische Musik doch schon zwangsläufig Schnee von gestern. Und dann gebe es bei den Verfechtern der Klassik als des einzig wahren Kulturguts auch noch diesen Ballon, „gefüllt mit der heißen Luft von Snobismus und Überheblichkeit.“
Allerdings pflegt Faber für sich ohne jede Vorbelastung einen ganz breiten und offenen Geschmack, der auch Ausflüge zu Musikrichtungen sehr eigener Klasse einschließt. Dazu hat er so gut wie jede Stilrichtung erkundet und es fließen hier auch Gespräche mit sehr unterschiedlichen Musikschaffenden ein.
Es ist ein Genuss, all das zu lesen, wenn man Musik jeglicher Couleur und einen souveränen Sprachfluss voller intelligenten Charmes mit einem steten Hang zu satirischer Nonchalance zu schätzen weiß.
Das gilt dann auch für Kapitel wie über Musik, die er gar nicht mag wie von Liberace oder Chris De Burgh – nicht ohne zu erklären, warum. Oder einige Schilderungen über „Gute Kunst von schlechten Menschen“ wie z.B. R. Kelly (verurteilter Sexualstraftäter).
Um so mehr berührt das Kapitel „The Tracks of my Tears“. Es gibt so viele Wirkungen der Musikgenüsse bis hin zu Glücksgefühlen oder Euphorie. Aber auch das ein oder andere, das sehr individuell im Wortsinne zu Tränen rührt. Faber beschreibt für sich selbst ein solches, das ihn unwiderstehlich und immer wieder entsprechend reagieren lässt.
Michel Faber wird zuweilen geradezu philosophisch und wirft durchweg einen originellen, oft sehr persönlichen und immer wieder auch provokanten Blick auf Musik in all ihren Ausformungen. Der Genuss an diesem außergewöhnlichen Buch wird jedoch ein wenig davon abhängen, ob man einen gewissen Bezug zur Musikwelt vor allem des 20. Jahrhunderts hat.
# Michel Faber: Hör zu! Was Musik mit uns macht (aus dem Englischen von Bernd Gockel); 542 Seiten; btb Verlag, München; € 28
WOLFGANG A. NIEMANN (wan/JULIUS)
