- Geschrieben von: Wolfgang A. Niemann
- Kategorie: Belletristik (Non-Fiction)
- Zugriffe: 174


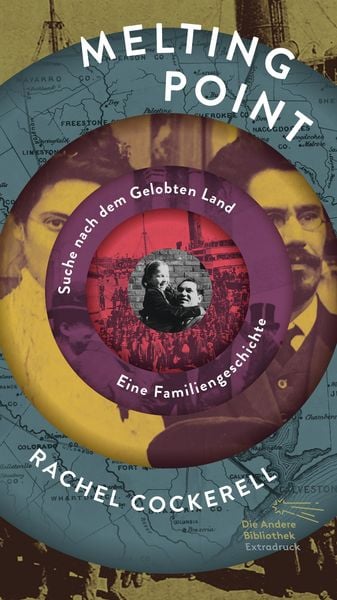
RACHEL COCKERELL: „MELTING POINT“
„Wenn wir das Heilige Land nicht bekommen können, können wir ein anderes Land zu einem heiligen machen.“ Dieses Zitat ist ähnlich vergessen wie Israel Zangwill (1864-1926), der es 1906 aussprach und der zu jener Zeit einer der berühmtesten und weltweit bekannten Zionisten war.
Auf ihn und sein Wirken stieß die junge negliche Historikerin Rachel Cockerell, als sie eigentlich nur eine Geschichte ihrer jüdischen Familie und deren Herkunft aus dem zaristischen Russland schreiben wollte. Dazu jedoch gehörte auch der Name ihres Urgroßvaters David Jochelman, der die Familie einst ins Exil nach London geführt hatte.
Eine kürze Erwähnung dieses Geschäftsmannes hätte reichen sollen, doch es eröffneten sich unvermutet quasi veregssene Aktivitäten dieses Zionisten, der sich mit dem anglo-jüdischen Schriftsteller Israel Zangwill anfreundete. Und Cockerell hörte erstmals vom sogenannten Galveston-Projekt, das der seinerzeit höchst erfolgreiche Autor ins Leben rief und das Jochelman ganz wesentlich organisierte.
Überwältigt begann Rachel Cockerell das erzählende Sachbuch mit dem Titel „Melting Point. Suche nach dem Gelobten Land. Eine Familiengeschichte“. Als solche war das Buch zwar geplant, doch die Autorin war unzufrieden mit ersten Ansätzen, denn warum sollte sie die Geschehnisse als Stimme aus dem 21. Jahrhundert darstellen, all die Originalquellen paraphrasieren und ihren Worten Gefühle der Akteure von damals wiedergeben?!
Und Cockerell startete aufs Neue, nahm sich gewissermaßen aus dem Schreiben und ließ die Originalstimmen sprechen. Mit überwältigendem Erfolg, denn dieses Erzählen mit Quellen aus Tagebüchern, Briefen, Memoiren, Zeitungsartikeln sowie Ton- und Bildaufnahmen schuf eine Unmittelbarkeit des jeweils Geschehenen, die ihresgleichen sucht.
Entstanden ist so eine Geschichte, die auf geradezu romanhafte Weise fesselt. Das gilt insbesondere für Teil 1 des Buches, in dem zunächst das Wirken Theodor Herzls im Mittelpunkt steht. Der Wiener Journalist hatte 1896 mit seinem Buch „Der Jüdische Staat“ den Zionismus ins Leben gerufen.
Zentrale Forderung war die Heimkehr der Juden ins Gelobte Land, also nach Palästina. Der Druck war groß, denn im Zarenreich kam es zu immer neuen, immer schlimmeren Pogromen. Doch Palästina war nicht unbewohnt und die Kolonialmächte sperrten sich. Allerdings gab es schließlich Angebote des British Empire „zum Zwecke der jüdischen Kolonisation in Ostafrika“.
Die Juden aber wollten einen eigenen unabhängigen Staat und der wurde bei der Suche auch in anderen Regionen z.B. in Australien, Angola oder Mesopotamien verwehrt. Auf dem 6. Zionistenkongress 1903 in Basel kam es schließlich zum Bruch zwischen Herzl und dem anderen großen Zionisten Israel Zangwill.
Pragmatisch der Not gehorchend propagierte Zangwill: Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land“ und rief die Jewish Territorial Organisation (ITO) ins Leben. Diese jüdische Gruppierung, die sogenannten Territorialzionisten. Bekannte sich zu einem „Zionismus ohne Zion“ und das große Pogram von Kischinau sowie die hohe Zahl weiterer Verfolgungen erhöhten den Druck.
Die USA waren zu jener Zeit bereits das Ziel hunderttausender Juden geworden, doch insbesondere New York war längst überlaufen. Wie die ITO dann auf Galveston in Texas kam und am 7. Juni 1907 tatsächlich das erste Schiff von Bremen aus nach dort aufbricht, das liest sich in all den Originalquellen sehr lebendig.
Dieses Galveston-Movement, initiiert von Zangwill, organisiert von David Jochelman und finanziert von dem Bankier Jacob Schiff, schaffte bis 1914 rund 10.000 russische Juden in die Hafenstadt am Golf von Mexiko, die sogar bereits eine Synagoge hatte, Verbreiten sollten sich die Emigranten über den gesamten Südwesten, von einer Staatsgründung aber war hier nicht mehr die Rede und in manchen jüdischen Kreisen wurde zudem die zu starke Assimilation in den USA kritisiert.
Der allgemeinen Geschichte schließt sich dann Teil 2 an und der hat nicht ganz die mitreißende Wucht der großen zionistischen Bewegung, denn nun geht es mehr in die eigentliche Familienchronik. Hier ist vor allem das titelgebende Theaterstück „The Melting Ppoint“ von 1908 und der Verfahre Emmanuel Jochelmann, der 1912 nach New York geht.
Es wird Theatergeschichte geschrieben und zu den Quellen zählen illustre Namen wie John Dos Passos und Ernst Hemingway. Teil 3 wendet sich dann David Jochelmans Ankunft in London zu, seinem ahnungsvollen Weggang aus dem Zarenreich und den direkten Vorfahren der Autorin.
Das alles liest sich wie ein sehr besonderer Roman und ist doch absolut authentisch bis hin zu Zeitungsmeldungen zur Staatsgründung Israels am 15. Mai 1948. Und es sind diese sehr unterschiedlichen, die in ihrer teils deutlichen Gegenläufigkeit für ein hohes Maß an Objektivität sorgen. Fazit: „Melting Point“ offeriert eine außerordentliche Geschichte, in ungewöhnlicher Erzählweise zu einem Meisterwerk geformt.
# Rachel Cockerell: Melting Point. Suche nach dem Gelobten Land. Eine Familiengeschichte (aus dem Englischen von Nina Frey und Cornelius Reiber); 455 Seiten, div. SW-Abb.; Die Andere Bibliothek, Band 487, - im Aufbau Verlag, Berlin; € 28
WOLFGANG A. NIEMANN (wan/JULIUS)
