- Geschrieben von: Wolfgang A. Niemann
- Kategorie: Belletristik (Roman/Krimi)
- Zugriffe: 59


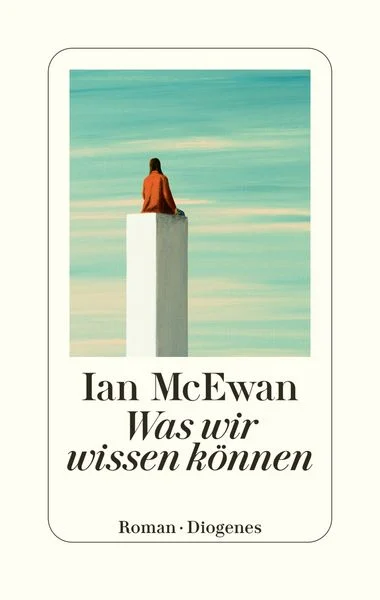
IAN McEWAN: „WAS WIR WISSEN KÖNNEN“
„Die Blundys und ihre Gäste lebten in einer Welt, die uns wie das Paradies vorkommt. Es gab einen größeren Reichtum an Blumen, Bäumen, Insekten, Vögeln und Säugetieren, wenn auch im Einzelnen immer weniger.“ Das vermerkt Thomas Metcalfe im Jahr 2119 über ein legendäres Fest im Jahr 2014.
Dieser junge englische Literaturwissenschaftler erforscht insbesondere die Literatur zwischen 1990 und 2030 und steht als Ich-Erzähler in Teil I von „Was wir wissen können“, des mittlerweile 18. Romans von Ian McEwan, im Mittelpunkt.
Metcalfe macht sich auf die beschwerliche Reise zur Bodleian Bibibliothek, wo er Material für sein ganz spezielles Forschungsanliegen zu finden hofft. Es geht um das sagenumwobene Langgedicht „Ein Sonettenkranz für Vivien“ des seinerzeit berühmtesten britischen Lyrikers Francis Blundy.
Am Geburtstags seiner Frau las der sehr von sich überzeuget Poet dieses Gedicht von einem echten Pergament ab, dem einzigen Exemplar des niemals abgedruckten Gedichts. Doch ohne das verschollene Gedicht ist das Rätsel desselben quasi unauflösbar.
War das große Werk ein Meisterwerk der Liebesdichtung oder – so kritische Zeugen – eher eine raffiniert umschriebene Abrechnung des Dichters mit der zerbrochenen Ehe und sogar mit einem versteckten Mordgeständnis darin. Allerdings muss man sich fragen, wie viel Relevanz eine solche Untersuchung literarischer Finessen angesichts der realen Wirklichkeit haben kann.
Die nämlich macht verständlich, warum Metcalfe die Zeit des zur Legende gewordenen „Zweiten Unsterblichen Abendessens“ im Mai 2014 als paradiesisch und offen für eine wunderbare Zukunft glorifiziert. In seiner Gegenwart von 2119 ist die Welt ein trister Ort geworden, nachdem durch Entscheidungen der KI einzelnen atomare Konflikte ausbrachen. Die neben der Freisetzung von Radioaktivität unter anderem verheerende Tsunamis auslösten, so das Städte wie Hamburg und New York nicht mehr existieren und das Vereinigte Königreich zu einem Archipel einzelner Inseln geworden ist.
Die Menschheit wurde dadurch und das Fortschreiten des Koimawandels mehr als halbiert und das Leben ist nicht nur wegen gravierender Mängel an sehr vielem recht trostlos geworden. Selbst kurze Reisen sind gefährlich geworden und größere schlicht unmöglich. Vielleicht ist da womöglich gerade da eine Flucht in kulturelle Vergangenheitsmomente eine fruchtbare Ablenkung.
Und Metcalfe gelingt es, aus der komplexen Melange von Fakten und Vermutungen ein glaubhaftes Bild zu erstellen über den Dichter, sein Leben und sein Werk. Selbst die Geschehnisse der legendären Lesung vermag er zu ermitteln und darzustellen.
Um in Teil II grandios düpiert zu werden. In einem seiner typischen literarischen Zauberkunststücken überlässt Booker-Preisträger McEwan nun nämlich das Erzählen Francis Blundys Ehefrau Vivien. Offenbar hatten die offiziellen Erkenntnisse, wie sie Thomas Metcalfe erforschte, die Realität erheblich vernebelt, und es folgen bizarre Enthüllungen und Bekenntnisse, die alle bisherige Überzeugungen ins Leere laufen lassen.
Nach dem zuweilen geradezu akademischen bis abgehobenen Bericht des Literaturwissenschaftlers folgt hier nicht weniger als die spannende Desillusionierung der vermeintlichen Realität, die selbst verbrecherisches Tun nicht außen vor lässt. Und auf die Feststellung des Titels „Was wir wissen können“ hin könnte man sich sehr wohl fragen: „Wollen wir das wirklich?“
Fazit: dieser Roman bietet ein anspruchsvolles Gedankenexperiment mit einer Rückschau auf eine Vergangenheit, die unsere Gegenwart ist und in ihren subtilen dystopischen Warnungen durchaus schaudern lässt. Über die Meisterschaft in Stil und Charakterzeichnungen muss man im Übrigen nichts Neues hinzufügen.
# Ian McEwan: Was wir wissen können (aus dem Englischen von Bernhard Robben); 469 Seiten; Diogenes Verlag, München; € 28
WOLFGANG A. NIEMANN (wan/JULIUS)
